Der graue Nebel
schreibchenweiseWas uns nicht sofort tötet, das frisst uns langsam auf, kaut und schluckt, stößt auf und kaut erneut auf uns herum, bis alle Fasern fein zermahlen sind und jeglicher Inhalt Zersetzung gleicht.
Er starrte vor sich hin. Leere in seinen Augen, leere in seinem Kopf. Da war nichts, nur grauer Nebel. Und dieses Nichts schmerzte ihn. Kein Brennen, wie Salz in dem klaffenden Spalt einer von Wut zerrissenen Haut. Kein Ziehen, wie die Verschlingung krampfender Därme nach einem zu großen Schluck gelösten Rattengiftes. Kein dumpfes Hämmern, wie bei den Schlägen von schwerem Holz gegen einen dafür zu weichen Kopf. Und auch kein Stechen, wie beim Stauchen des Rückgrates nach dem Stoß vom Dach.
Das Nichts schmerzte grau und hohl und stumm und kalt und bitter und in all seiner Trivialität auf eine Schwindel erregende Art. Nicht sonderlich auffällig, aber nachhaltig. Er musste würgen, übergab sich, spie etwas von diesem Nichts auf den Boden unter seinen Füßen, betrachtete es, schob es mit der Schuhspitze zu einem Klumpen zusammen, versuchte seine Hässlichkeit zu ignorieren, versuchte seine Hässlichkeit zu deuten, drehte sich im Kreis, starrte es von oben an, kniete sich davor, roch daran, durchwühlte es mit den Fingern, stand auf, kehrte ihm den Rücken zu, entfernte sich ein paar Schritte, betrachtete es aus der Zimmerecke, kam zurück, legte sich daneben, starrte es an und stellte fest: Nichts.
Fünf Tage, einhundertzwanzig Stunden, siebentausendzweihundert Minuten, vierhundertzweiunddreißigtausend Sekunden später starb er. Schade. Er war im Kern ein netter Mensch, nur wusste er es nicht, niemand wusste es. Und niemand wird es je erfahren. Er starb wie er lebte, unauffällig. Der Tod durch Langeweile ist kein schöner, er hat keine schillernden Farben, keine prachtvollen Waffen, keinen blumigen Geschmack. Langeweile tötet geräuscharm, gemäßigt, geduldig und grau.
„Langeweile ist eine unangenehme Windstille der Seele“ Nietzsche
„In der schändlichen Menagerie unserer Laster ist eines noch hässlicher, noch bösartiger, noch schmutziger! Die Langeweile ist’s!“ Baudelaires
Weiße Gedanken
Pösie für Lieb & BösiEs schneit. Flockige kleine Augäpfel,
die das Grau zwischen meinem Himmel
und deiner Erde kosen.
Zwei davon mögen dir sein,
mir jetzt ein wenig mehr gehören als gestern noch,
mit ihren Blicken. Nur mir.
Und in der Stille schlagen ihre Wimpern,
kaum gefühlt. Haben mir mein Blut zerwühlt.
Und in der Stille sehen sie,
was nur ich sonst seh’ – den Schnee…
… und meine weißen Gedanken.
Eine wahre Geschichte – sagt M
schreibchenweiseEine Nacht kann lang sein, oder auch verdammt schnell vergehen. Diese Nacht war lang. Mindestens zwei Menschen schliefen nicht. Und einer erzählte am folgenden Tag eine Geschichte.
Kaltes Metall stößt zweimal an seine Schläfe. „¡Apúrate!“ M wagt kaum zu atmen. Das Eisen an seinem Kopf duldet keine heftigen Bewegungen und schon gar keinen Widerstand. Der Mann hinter ihm stinkt nach Gewaltbereitschaft. „¿Cuánto es? ¿Cuánto es?“, drängt eine zweite Stimme. Ungeduld färbt sie schrill. „Bastante. Vamos pues.“ M wird vom Geldautomaten in Richtung eines Autos gestolpert. Zwei behandschuhte Hände stoßen ihn auf die Rückbank, zwei weitere stecken seinen Kopf in einen Sack, Schwarz, fesseln seine Hände hinter dem Rücken, Schmerz. Alles geht so verdammt schnell. Säuerlicher Geruch steigt in Ms Nase, beißt sich durch die Nebenhöhlen in den Stirnlappen. Der Wagen springt an, M wird in die Rückenlehne gedrückt. Angst. Schweiß. Kalte Gedanken. Noch mehr Angst. Gefühlte Stunden fällt kein klar verständliches Wort, nur verflüsterte Absprachen, gebrüllte Flüche. Das Auto jammert. Nächtliches Wirrwarr der Straße dringt durch seine marode Karosse, Benzingestank erkriecht sich den Innenraum. Eine Kurve, noch eine, Unwegsamkeit quält das Auto, Schonungslosigkeit das Getriebe. M lauscht, sucht nach Vertrautem, sucht nach Halt, bekommt einen Hieb. Die Dunkelheit wird schwärzer, berauscht. Nebel im Kopf. Stille.
„Coño de la madre, que…“ Jemand zerrt an Ms linker Hand, versucht sich am Finger. „Le va a cortar. ¡Joder!“ Klickgeräusche. Panik. Draußen rauscht die Nacht mit geschlossenen Augen und verwachsten Ohren vorbei. „Nein, nein, nicht den Finger, nicht den Finger!“ Wieder schlägt hartes Eisen gegen Ms Kopf. Süßer Geschmack schleicht in den Mund. „Hurensohn!“ Vertraute Sprache, wütender Akzent, weiterer Schlag, diesmal in die Seite, Zerren am Finger, die Klinge setzt an. „Déjalo, puta madre!“ Der Finger bleibt verschont. Eine Tür wird geöffnet, Füße treten M aus dem Wagen. Harter Boden, alles schmerzt, Kopf schlägt gegen Unbekanntes, Abgase entfernen sich. Nebel im Hirn. Die Nacht stinkt. Stille.
Die Sonne steht hoch, gleißt auf einen gekrümmten Körper, der am Straßenrand liegt, verschnürte Arme auf dem Rücken, der Kopf in einem schwarzen Sack, die Füße nackt, an der linken Hand ein Ring. M stöhnt, richtet sich auf, lauscht. Keine Chance, die schmerzenden Hände zu lösen. M auf den Knien, langsam vorwärts tastend, innehaltend, lauschend, weiter auf den Knien. Ms Schulter stößt gegen einen Widerstand. Eine Wand? Ein Baum? Bestiefelte Beine? Innehalten. Kein Atemzug. Kein Stoß gegen den Kopf folgt, kein Fluchen, kein metallisches Klicken an der Schläfe. Ausatmen. M reibt seinen Kopf am Widerstand, schiebt kratzigen Stoff über die Augen, blinzelt. Ein Baum. M sackt zusammen. Der Baum bewegt sich keinen Millimeter, wehrt sich nicht, droht nicht, bietet Halt.
Sechs Stunden später zurück in Caracas, blutige Füße, nasses Hemd, schmutzige Augen. Keine Papiere, keine Schuhe. Am Finger ein Ring. „Frag nicht.“ Tue ich nicht. Stille.
Vögel haben eigentlich immer Fieber
schreibchenweiseDie normale Körpertemperatur des Menschen schwankt um die 37 Grad. Rektal gemessen bekommt man den genauesten Wert. Unter 33 tut es fast nicht mehr weh, ein Geniestreich des Gehirns…
„Entschuldigen Sie bitte, aber so wird das nichts.“
„Sie machen mich nervös. Wenn Sie mich so anstarren, das irritiert mich eben. Es ist auch für mich das erste Mal in der Form.“
„Tut mir leid, ich wollte Sie nicht kritisieren, aber ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Ich möchte, dass es perfekt ist. Es muss perfekt werden, wissen Sie, was ich meine?“
„Ja, das weiß ich. Es ist nur eben nicht so einfach, das, was man weiß, auch in die Praxis umzusetzen. Und wenn Sie mir dann auch noch so auf die Finger gucken, macht es das nicht besser.“
„Dann lass ich Sie jetzt einfach mal machen. Ich vertrau Ihnen voll und ganz. Ihre Referenzen sind tadellos.“
Für einen Moment durchbricht Stille das Zimmer, teilt es vom Rest der Welt. Nein, das wäre übertrieben, aber vom Rest des Hauses. Der Mann mit den schlanken Fingern nickt und widmet sich weiter seiner Aufgabe, die nun seine volle Konzentration fordert.
„Wissen Sie, ich hatte Sie mir ganz anders vorgestellt, irgendwie größer. Sie wirken so zart. Darf ich das sagen oder beleidige ich Sie damit?“
„Nein.“
„Ich hatte mal einen Schulfreund, dem sehen Sie etwas ähnlich, Norbert Schenker*. Sie kennen Ihn nicht zufällig, oder?“
„Nein, wieso denken Sie, ich könnte ihn kennen?“
„Es wäre doch möglich, dass Sie verwandt sind, Brüder vielleicht sogar. Haben Sie denn einen Bruder?“
„Finden Sie, wir sollten solch intime Details austauschen, während wir…?“
„Nein, Sie haben Recht, das wäre albern. Ja, da haben Sie Recht. Sie sind ja auch der Profi von uns beiden.“
„Ja.“
„Obwohl ich mich schon ein wenig wundere, dass es auch für Sie das erste Mal ist und dass Sie so nervös sind. Sie wirken sehr nervös. Ich dachte, Sie machen das öfters.“
„Tue ich auch, aber eben nicht so wie bei Ihnen jetzt.“
„Verstehe. Kann ich denn etwas tun, das Ihnen die Sacher erleichtert? Sagen Sie mir, was ich tun soll, vielleicht hilft Ihnen das. Ich bin auch gut in einigen Dingen.“
„Nein, bitte, ich versuche mich zu konzentrieren. Es ist wirklich nicht einfach, wenn Sie ständig dabei reden.“
„Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nur etwas aufmuntern, die Stimmung heben. Ich bin jetzt still und begebe mich ganz vertrauensvoll in Ihre Hände. Sie haben übrigens sehr schöne Hände. Entschuldigung, ich bin schon ruhig, machen Sie bitte weiter.“
In der Wohnung über dieser wird lautstark eine Tür geschlossen, dem Geräusch folgen Schritte durch den Hausflur, entfernen sich unter dem Fenster die Straße hinab. Auf dem Fenstersims sitz ein Vogel. Er starrt hinein.
„Wir haben einen Gast, schauen Sie mal, der beobachtet Sie auch. Das ist fast schon Ironie, finden Sie nicht?“
Tiefes Einatmen.
„Entschuldigen Sie. Ich halte mich zurück. Machen Sie bitte weiter, das ist sehr gut so.“
Einige Minuten beobachtet der Vogel die beiden Männer, putzt sich dann ausgiebig das Gefieder, schüttelt sich einmal kräftig, plustert sich auf und huckt sich hin.
„Da sitzt er nun. Scheint sich wohl zu fühlen hier bei uns. Haben Sie gewusst, dass alle Vögel eine immer konstante Körpertemperatur haben?“
„Nein, das wusste ich nicht.“
„Die liegt bei 42 Grad. Das ist höher als bei allen anderen Lebewesen. Eigentlich haben die immer Fieber.“
Jetzt starren beide auf den Vogel und der Vogel starrt zurück. Im Zimmer ist es heiß.
„Was meinen Sie, wie lange Sie noch brauchen?“
„Wenn es gut werden soll, müssen Sie bitte noch etwas Geduld haben. Schaffen Sie das?“
„Aber ja doch, keine Eile. Ich habe mir extra für Sie den ganzen Tag frei genommen.“
Jetzt müssen beide lachen und der Vogel fliegt davon.
„Der war nicht schlecht.“
„Ja, ich gebe zu, den hatte ich geplant. Ich wusste zwar nicht genau, wann und in welchem Zusammenhang ich ihn heute bringen könnte, aber ich hatte ihn geplant.“
„Sind Sie jetzt bereit?“
„Ja, ich denke, ich bin soweit. Lassen Sie es uns vollenden.“
Langsam gleitet das Skalpell durch weiches Fleisch. Wie ein befreiter Fluss ergießt sich Rot auf sauber ausgelegter Folie. Ein Gesicht ist schmerzverzerrt doch glücklich, ein Gesicht hoch konzentriert. Aus einem Gesicht weicht mehr und mehr das Leben, das andere ist hoch konzentriert. In einem Gesicht schließen sich die Augen. Zwei andere blicken hoch konzentriert.
* Norbert Schenker ist eine erfundene Person.
Lachen
Indonesia & MalaysiaNosey
Horse - of course!Lovely Morning
Horse - of course!Der Schlangenlederkoffer
schreibchenweiseDie Uhr der Vergangenheit tickt manchmal schneller. Dann holt sie mich ein mit ganzer Kraft.
… und mit der Linken umklammerte sie den Griff ihres Koffers. Schlangenleder. Er war das Einzige, was ihr noch blieb. Ein Python ließ dafür sein Leben, wurde aus seiner Haut gerissen. Wie ihr Bruder, der dort vor ihr hing. Zu junge Füße unter zu alten Balken. Exkremente bildeten verkrustete Schatten, krochen über den Boden. Irgendwo stahl eine Krähe den Rest Menschlichkeit aus einem Leib. Hanf schnitt in Gebälk wo einst ein Leuchter hing. Nun trägt es tote Körper. Beim Anblick schwommen ihr die Augen. Ihr Herz blutete. Bald war es leer. Nur die Gedanken liefen fort, wie sie vor langer Zeit. Bevor das alles begann, dieser Wahnsinn. Jetzt war sie zurück, starrte auf den Tod, der ihr mit Gestank und Hässlichkeit entgegenschlug.
Einst ging ich fort,
um zu vergessen.
Dann kam ich zurück an diesen Ort
und wurde erinnert.
Es ist nicht die Zeit, die geht.
Es sind die Menschen,
die einen Moment nur in ihr wohnen.
Als sie sich umdrehte war da keine Tür mehr, die sie hätte schließen können, nur Schutt, Asche, erstarrte Lebendigkeit und tote Erinnerungen. Vor Jahren war es noch so einfach gewesen, eine Tür zu finden. Da war ein Haus, da war eine Familie, da war ein Tor zum Öffnen mit einem Weg davor, ihrem Weg, an dessen Ende er auf sie wartete. Alles ließ sie hinter sich, ihren Namen, ihre Identität, die Tränen der Mutter, den zornigen Finger des Vaters, das leise Weinen des Bruders. Er hielt ein Häschen in den Armen, sie nur einen einzigen Koffer. Schlangenleder. Ein Python ließ dafür sein Leben. Er hatte keine Wahl als man ihn häutete. Sie wählte das Ungewisse als sie ging. Doch sie ging mit schnellem Schritt, mit erhobenem Kopf und mit weißer Spitze unter ihrem Kleid…
Dies ist der Beginn einer Geschichte, nicht meiner. Es ist die Geschichte meiner Großmutter, die ich irgendwann vielleicht erzählen werde.
Bike & Birke
Indonesia & Malaysia212
schreibchenweiseUnd er lächelte, als er dich so liegen sah, mit diesem fadenscheinigen Rinnsal, das aus deinen Wangen kroch. Es roch nach Erdbeeren und Leid, nach welken Gedanken und schalem Schmerz. In einem Käfig sang ein Vogel nicht mehr. In deinem Mund erbrach sich Leben. In deinen Augen starb das Blau vor sich hin. Er hielt noch immer das Messer in deinem Herzen, da warst du schon lange fort. Ein Flüchtling in Phantasien. Während er an deinem Blut leckte, kroch dein Geruch bereits die Wände hinauf, 212, ergoss sich über dem Himmel in dir. Hässlichkeit ist keine Frage der Betrachtung, sie zahlt Miete, lenkt deine linke Hand. Und als der Mond erwachte, da ging er einfach aus der Tür.
Der neue Tag beginnt ohne dich. In einem Laden an der Ecke wird ein neues Messer gekauft. Tot. In einem Laden daneben ein neues Herz. Schlag. Und er lächelt noch immer, „… was für eine beschissene Farbe hatte diese Tür!“
Es war nett, mit Ihnen zu plaudern
schreibchenweiseEntschuldigung, ist hier noch frei? Danke. Wissen Sie, ich kannte mal einen, der war Ihrem hier sehr ähnlich. Ich erinnere mich noch, wie er da saß, der Herr Kowalski, etwas umständlich zwar, auf einer Arschbacke nur, die Eier eingeklemmt auf kaltem Unterboden, doch das war nicht sein eigentliches Problem, denn es goss in Strömen, und Herr Kowalski mochte keinen Regen. Um ihn herum bildete sich bereits eine dunkelbunte Pfütze, die er steif und fest zu ignorieren schien ohne eine Mine zu verziehen, und obwohl die Pfütze sich immer weiter ausdehnte und auch an Tiefe gewann, tat er tat keinen einzigen Schritt, weder vorwärts noch rückwärts, weder aus der Pfütze heraus noch um sie herum noch in sonst eine Richtung. Und so wurde er nass und nässer. Gummistiefel wären definitiv von Vorteil gewesen, doch die besaß Herr Kowalski nicht. Auch keinen Schirm. Nicht einmal einen wasserfesten Hut. Der hätte an ihm auch recht albern ausgesehen, ähnlich albern wie Gummistiefel, obwohl es die in wunderschönen und Herrn Kowalskis Äußeres aufgreifenden Farben gab, mit und ohne Musterung, mit verschiedenen Schafthöhen und unterschiedlicher Besohlung. Ich selber trage abwechselnd zwei Paar schöner Gummistiefel. Die einen haben Streifen und changieren von lichtem Grün zu pudrigem Rosé. Das andere Paar, mit einem nicht ganz so hohen Stiefelschaft ausgestattet und daher für weniger starke Regentage mit niedrigerem Pfützenstand sehr gut geeignet, besitzt Flecken in der Form und Farbe, wie sie Leoparden auf ihrem Fell zur Schau stellen. Das passt, denn das Fell von Leoparden und artverwandten Raubkatzen ist sehr gut imprägniert und dadurch ein sehr guter Schutz gegen die raue Natur, zu der auch Regengüsse zählen – genau wie meine raubkatzengemusterten Gummistiefel. Ich hatte mal einen Kater, der muss in seinem Familienstammbaum auch einen echten Wildfang gehabt haben, denn dieser Kater – ich nannte ihn Tüte, weil er kurz nachdem ich ihn abgemagert und ausgemergelt aus einem Feuer gerettet hatte, ihn mit Schlagsahne und Eigelb aufgepeppelt und ihm mit Brandsalbe die offenen Pfoten versorgt hatte, als erstes vor Angst in eine herumliegende Plastiktüte flüchtete – trug in seinem Fell ebenfalls dieses raubtierähnliche Fleckenmuster, das unseren überzüchteten Stubentigern über die Jahre der Domestizierung irgendwie abhanden gekommen zu seien scheint und einem reinen Streifenkleid gewichen ist. Tüte hatte beides, wilde Flecken und domestizierte Streifen. Genau wie meine Gummistiefel. Also wenn ich einen rechten von dem einen Paar und einen linken des anderen anziehen würde, könnte man mir eine gewisse Ähnlichkeit mit Tüte nachsagen. Was ich natürlich nicht tat und auch zukünftig nicht vorhatte, also das Tragen zweierlei verschiedenfarbiger Gummistiefel an unterschiedlichen Füßen. Es sei denn, ich verlöre den einen der Streifenstiefel oder den anderen der gefleckten. Aber warum sollte ich. Ich trage entweder die gestreiften oder die gefleckten. Punkt. Es ist ja nicht so, dass ich keine Wahl hätte, so wie Tüte. Der hatte keine Wahl, weder bei der Färbung und Beschaffenheit seines Beinkleides noch bei der Wahl seines Retters. Dabei hatte er ausgesprochenes Glück, an mich geraten zu sein. Es hätte ihn auch richtig schlimm treffen können. Er hätte ganz und gar verbrennen können und nicht nur fast, oder ein anderer Mensch, ein weniger tierlieber, als ich es war, hätte ihm einfach eins mit dem Spaten über den verqualmten Kopf mit den verbrannten Schnurrhaaren ziehen können, statt seinem Wimmern zu folgen und ihn zwischen glühenden Restwurzeln und dampfendem Dreck hervorzufischen. Ich hingegen, ich nahm mich seiner an, ohne auch nur eine Minute zu zögern. Obwohl ich keine Gummistiefel trug an diesem Tag. Es regnete ja auch nicht. Hätte es geregnet, dann wäre womöglich gar kein Feuer ausgebrochen, in das der arme Kater, das kleine Häufchen Elend, geraten wäre. Oder der Regen hätte das Feuer rechtzeitig gelöscht noch bevor das Tierchen halb darin verkohlt wäre. Aber es regnete nicht. Darum trug ich auch keine Regen abweisenden Schuhe. Als ich Tüte fand, kleideten mich Sandalen. Ich kann wunderbar Sandalen tragen, denn ich habe schöne Füße. Eine Sandale setzt einen schönen Fuß voraus, zwei Sandalen natürlich auch entsprechend zwei schöne Füße, auch wenn nicht viele in diesem Land meine Meinung dazu zu teilen scheinen, geht man nach der Wahl ihrer Beschuhung in Bezug auf die Beschaffenheit ihrer Füße, da sich diese nicht selten in einem recht unordentlichen Zustand befinden und sie selbige dann auch gerne in noch unschönere Sandalen stecken. Unschöne Füße in unschönen Sandalen gehören verboten. Auch unschöne Füße in schönen Sandalen. Für unschöne Füße sind Gummistiefel die bessere Alternative zu Sandalen, egal, ob schön oder nicht. Auch bei nicht vorhandenem Regen. In diesem Fall schützen sie den Träger nicht vor Nässe sondern die Mitmenschen vor einem unästhetischen Anblick. Ich fände es manchmal ganz angenehm, wenn wir uns alle mehr um das Wohl unserer Mitmenschen sorgten. Nicht, dass ich jetzt meinem Nachbarn, der im Übrigen über ein sehr unschönes Paar Füße verfügt, die ich einmal die Woche unfreiwillig zu Gesicht bekomme, da er es sich zur Angewohnheit gemacht hat, seine überaus sprießfreudigen Zehennägel im gemeinsam genutzten Hausflur zu beschneiden, und zwar immer genau dann, wenn ich morgens mit noch leerem Magen meine Wohnung verlasse, um zur U-Bahn zu eilen, ständig meine Gutmenschattitüde aufdrücken müsste. Aber ab und an sorge ich für ihn, indem ich ihm ein bis zwei Flaschen Bier mitbringe oder, wie erst kürzlich, ihm einen nagelneuen Fußabtreter vor die Tür lege, nachdem er meinen mehrfach malträtiert und damit etwas überstrapaziert hatte und sich mittlerweile ein kleiner Berg Schmutz unter meinem Abtreter anzusammeln begann, der nicht allein von mir stammen konnte. Ein Schmutzberg, der jeden Mittwochmorgen von unserer nicht ganz billigen Hausputzmannschaft gewissenhaft umreinigt wurde. Wenigstens entfernten sie die abgetrennten Fußnägel meines Nachbarn von den Treppenstufen. Dafür war ich jede Woche überaus dankbar und zahle gern die allmonatliche Erhöhung der Nebenkosten, Posten für Hausreinigung. Manchmal frisst auch die Katze von Gegenüber die Nägelreste noch vor dem Reinigungstrupp. Katzen und Hunde mögen abgestorbenes Gewebe, das weiß ich, denn der Hund meiner Cousine – der leider erst vor kurzem verstarb und Herr Kowalski hieß, was ein recht ungewöhnlicher Name für einen Hund ist, aber weil er auch ein recht ungewöhnlicher Hund war, passte der Name dann doch irgendwie – der liebte es, wenn man sich die Fingernägel feilte. Dann legte er einem seinen riesigen Kopf mit den Langen braunen Schlappohren auf die Knie, und mit stechendem Blick hypnotisierte er die Nagelfeile solange, bis man das Schmirgeln unterbrach, innehielt und ihm die Feile vor die Nase hielt. Etwas unappetitlich anmutend und für mich als Mensch auch in keiner Weise nachvollziehbar, beschnüffelte Herr Kowalski erst genussvoll das Feilwerkzeug um es dann in ganzer Ausgiebigkeit abzulecken. Das und Pansen mochte Herr Kowalski. Aber er mochte nicht im Regen gehen. So, hier muss ich raus, es war nett, mit Ihnen zu plaudern.
Hypnoseblick
TierischDramatisches Dalmatien
augenscheinlichWater Boy
augenscheinlich, Portraits & Co.Tangente für eine Nacht
schreibchenweiseKaffeekrusten zieren sein Gesicht, bilden Ringe unter den Augen. Sie schlafen offen, kundig, und starren dabei in den Rauch. Bitte nicht stören steht auf seinen Lidern, nur sieht das niemand. Hätte er noch Atem, er würde ihn verschenken. Nun stinkt sein Hals. Nach Kippen. Nach Kaffee. Nach Magensaft und rezeptfreien Mitteln gegen Sodbrennen. Draußen ist es hell. In ihm schwitzt Dunkelheit. Sie kriecht durch Hautkanäle und verseucht sein Hemd. Weiß kann viele Farben haben. Schwarz schmeckt immer gleich. Rot ist versiegt.
Am Himmel glotzte der Mond. Feuchte Straßen zogen feine Linien über die Welt. Tangenten möchte man sie nennen, doch berührten sie niemanden. Passanten, die flüchteten. Flüchtigkeitsfehler. Jede Lebendigkeit hatte sich verkrochen. Manche Nächte sind nicht von dieser Welt. Manche Welten versinken in einer Nacht.
Seine Welt war heil, so heil wie ein angebissener Keks. Sie krümelte ihm vor die Füße, doch jeder Bissen schmeckte süßer. Er war Tangente für eine Nacht, sie die Kurve. Ihr Berührungspunkt schnitt tief. Adern stellen keine Fragen, sie bluten einfach aus. Verschenken sich. Verkrusten langsam. Verstummen irgendwann.
Sie sprach nicht zu ihm in dieser einen Nacht. Er antworte stumm. Auf ihre Bewegungen, die ihn an Abgründen wandeln ließen, auf ihren Blick, der bohrende Liebkosung war. In Gedanken wurde Jetzt zu Ewig. Unendlichkeit trägt schöne Kleider, darunter ist sie nackt. Er verglühte an ihr. Im Innern. Sie vergab sich an ihm, nur äußerlich. Manche Menschen sind nicht von dieser Welt. Manche Welten vergehen an einem Menschen.
Als sie ging, nahm sie ihn mit. Zurück blieb seine Hülle und das Schild an der Tür. Bitte nicht stören stand darauf. Ohne sie lag sein Leben leer vor seinen Füßen. Zusammengefegt. Einsamkeit, er wollte sie zertreten. Ihr Geruch hing noch immer schwer in der Luft, erdrückte ihm das Atmen. Er wollte ihn versiegeln, in sich, im Jetzt und in der Ewigkeit.
Die Plastiktüte von seinem Kopf ist bereits entfernt, als sie in wiedersieht. Er liegt kalt, das Blau seiner Augen verschlossen, die Adern sind ausgetrockneter Fluss. Sie nickt und geht. Tangente für eine Nacht, jetzt kennt sie seinen Namen.
„Eine Tangente kann in der Regel nur existieren, wenn die zugrunde liegende Funktion differenzierbar ist.“
„Als Differenzierbarkeit bezeichnet man die Eigenschaft einer Funktion, sich lokal um einen Punkt in eindeutiger Weise linear approximieren zu lassen.“
„Approximation ist zunächst ein Synonym für Näherung.“
… und Nähe war für ihn nur eine Idee.
Quelle Zitate: Wikipedia
Die Suche des Herrn Kudo
schreibchenweiseSchöner wohnen kann jeder. Mann muss es auch wollen.
Herr Kudo war unruhig, seit zweieinhalb Jahren nun schon. Sein Zimmer lag leer zwischen den Wänden. Etwas fehlte dort, etwas, das Wohnlichkeit verströmte, etwas, das auf ihn wartete, wenn er des Abends heim kam, etwas, auf das er wahlweise seinen jungen doch schon recht verkniffenen Arsch oder sein müdes, schwarz-vergeltes Haupt betten konnte. Oder auch beides. Ihm fehlte ein Sofa.
Das alte war längst abgenutzt. Es hatte lange schon an Glanz verloren. Das Leder klaffte eingerissen, ein marodes Bein musste durch mehrere Bücher ersetzt werden, Bücher, die Herr Kudo gerne als Requisit in seinem Regal gelassen hätte, stärkten sie doch seine intellektuelle Präsenz gegenüber eventuell vorbeischauender Gäste. Es roch – das Sofa, die intellektuelle Masche dagegen, stank ein wenig mehr noch. Das ist eine andere Geschichte.
Patina hat so ihren Reiz, doch in seiner Verlebtheit wirkte das alte Sofa nicht einladend genug, als dass man sich in dessen vertrockneter Haut hätte wohlig vergraben wollen. Eine bunte Decke konnte das verblasste Antlitz des Möbels zwar flüchtig verstecken, doch darunter lauerte Schwund. Eines Tages setzte Herr Kudo das ausgediente Möbel einfach vor die Tür, mitsamt des bunten Fummels. Allein drei zarte Stühle blieben ihm zum Halt. Nun wollte er – nun brauchte er – ein neues Sofa. Und so begann die verzweifelte Suche des Herrn Kudo.
Doch wie nur wie müsste dieses neue Möbelstück geschaffen sein? Es gab derer so viele und alle schienen das gleiche Versprechen zu geben – Geborgenheit. Manche waren verschwenderisch gepolstert, andere elegant und feinbeinig. An einigen sah er viele Verzierungen ohne jeglichen Nutzwert zwar, allein, sie waren hübsch anzuschauen. Manche überzog ein samtenes Weich, andere wirkten weniger pussierlich possierlich, machten aber durchaus einen robusten und praktischen Eindruck, Eigenschaften, die nicht zu unterschätzen waren. Dann gab es diese billigen, mit Plastik überzogenen und in unmögliche Farben getauchten, die sich grell ins Hirn stürzten und dabei das Augenlicht zertraten. Beim Sitzen quietschten sie, das lärmte unschön hochfrequent. Auch gab es solche, die still in einer Ecke standen, kaum wahrnehmbar in ihrer Unterwürfigkeit. Womöglich hätte ein zweites Probesitzen die inneren Werte erst zum Vorschein gebracht, eine versteckte Schublade vielleicht oder ein verträumtes Detail. Dies zu entdecken, dazu kam es oft gar nicht, vergeudete es doch Herrn Kudos kostbare Zeit. So manche Sitzgelegenheit schien auf den ersten Blick wie maßgeschneidert für diesen einen Arsch. Und dann gab es wieder andere, die waren gar für mehrere Sitzpartner offen. Mehrsitzer. Reihensofas. Das konnte man mögen, musste es aber nicht. Herr Kudo wollte sich hier noch nicht festlegen. Ach.
Außerhalb des nackten Zimmers erstreckte sich eine paradiesisch verkleidete Welt voller Sitzmöbel. Was tat Herr Kudo nicht alles, um unter ihnen dieses eine, das seinige, zu finden, das Sofa, das am besten zu ihm passte, das ihn allabendlich auffing, ihm die verschlummerten Sonntagnachmittage versüßte, ihm die Angst vor der Nacktheit seiner Wände und den Inhalten seiner Bücher nahm, eines, das ihm stundenlang zuhören könnte, wenn er aus seinen ordentlich sortierten Schlauheiten rezitierte? Tage durchstreifte er die Stadt, saß mal hier und lag mal dort zur Probe, bettete Haupt und Hintern bald in diese, bald in jene Richtung, liebäugelte mit dem einen Möbel, dann wieder mit dem anderen, ließ sich ein und dasselbe Modell in unterschiedlicher Couleur vorführen, vergrub seine Gliedmaßen mal tief in sündigem Rot, dann wieder strich er feinhändig über distinguiertes Grau. Und allmählich schien ihm die Suche köstlicher als das Finden. Die Vorfreude, wenn in jenem berauschenden Moment der schützende Überwurf von einem unbeschmutzten Sofa glitt und die ganze Schönheit eines zarten Kanapees freigab, sich der betörende Duft frischen Leders eines exzentrischen Diwans in die Lenden schlich oder das prudrige Pastell einer grazilen Couch verhuschte Sommernächte versprach. Ach.
Herr Kudo war im Rausch. Doch jedes Mal, wenn er in sein Heim trat, überfiel ihn diese beifallslose Einsamkeit. Die sinnlichen Stunden seiner Suche am Tage zerbröselten zur staubigen Farblosigkeit in der Nacht. Es kam, was kommen musste. Die einsamen Nächte des Herrn Kudo verloren an Stunden, sie wurden dünn. Die suchtenden Tage hingegen, wusste er zu dehnen, sie streckten ihre Finger nach ihm aus. Klammerten. Glücklich war er dennoch weder bei Licht noch in der Dunkelheit und eine schleichende Entropie nahm Besitz von ihm. Die Zeit verlor sich im Raum und Herr Kudo verlor sich auf seiner Suche…
Eisprinzessin
augenscheinlich, Portraits & Co.Januar, Februar, März… und dann kam August
schreibchenweiseEin Jahr ist lang. Zwölf Monate, vier Jahreszeiten. Und nur ein Leben.
Ich fickte Suse, das war im Januar. Vier Wochen Wollust, Schweiß und Bier. Dann hatte ich die Nase voll und Suse dicke Tränensäcke. Im Februar traf ich auf Nina. Die hatte schöne Beine, schlank und ohne Adern. Meine Augen mochten sie, meine Kumpels auch. Zu sehr. Nina war eine Bitch. Eine Bitch mit Damenbeinen, die sich bereitwillig für jeden öffneten. Ich teile so ungern. Im März blühte Sarah neben mir auf. Knospen wie Röschen. Liebliches Möschen. Doch im Kopf, da fuhr sie noch Dreirad. Als Sugardaddy war ich zu jung, als Bruder zu heiß auf ihre Schamhaftigkeit. Mit der war es schnell vorbei. Und eine Jungfrau ohne das Jung verliert an Reiz. So kam der April, der war recht wechselhaft. Namen zogen wie Wolken vorbei, und hängen blieb nur ein Ausschlag am Sack. Als es Mai wurde, überkam mich die Langeweile, eine gewisse Sätte und Müdigkeit machte sich breit. Das hielt nicht lange an, denn der Juni wurde heiß. Natalie versüßte meine Sommernächte. Und die Tage. Und die Nächte. Und auch die Mittagspausen. Ihr Mund war Sünde, ihr Hintern leider nicht. Der war nur schlaff, obwohl sie so oft in die Hocke ging. Jane Fonda behauptete immer, davon gäbe es irgendwann einen Knackarsch. Wann war irgendwann? Im Juli hatte ich folglicherweise Sehnsucht nach prallen Arschbacken und klugen Gesprächen. Doch ich bekam Stille. Mein Telefon wurde abgeschaltet. Irgendwer hatte vergessen, die Rechnungen zu begleichen. Ich fühlte mich nackt. Und einsam.
Und dann kam August. Er war mein Stern im Sommerloch. Seine Augen waren Meere. Sein Haar war Rabenfedern gleich. Er hatte so schöne Hände, dass mir schlecht wurde vor Entzücken. Und flink waren die. Sein Mund war potenzierte Natalie. Und erst sein Hinterteil, es brachte mich zum Weinen. Backen wie mit Samt überzogen, zum ficken geboren. Die lagen fantastisch in meinen Händen und ließen sich so zart spreizen, dass ich bei jedem Stoß meine sexuelle Verwirrung vergaß. Diese überrollte mich erst Monate später, zog mich in den Abgrund. Mein Stern erlosch. Mein Sommerloch brannte und mein Telefon schweigt noch immer. Draußen wird es jetzt wieder kälter. Willst’e Fi(lmgu)cken?
Gesichter mit Geschichten
Portraits & Co.Der Tag danach
schreibchenweiseDer Narr in mir lässt mich denken, alles Normale wäre logisch und alles Logische wäre normal. Es ist dieser Narr in mir, der mich zu Tode langweilt.
Durch den Fensterspalt dringen viel zu zeitig Sonnenstrahlen und Vogelstimmen. Letztere zwingen sich in meine mit Wachs verschlossenen Gehörgänge, bilden Ausschlag in meinem Hirn. Zwitscherblasen, gepiepster Herpes. Meine Augen wollen sich nicht öffnen, als hätten sie Angst, die tausend Sonnen verbrennen mich mitten durch die Pupillen. An meinen Wimpern klebt Marmor.
„Ich kann meine Füße nicht bewegen.“
Dann lass es doch.
Neben mir sitzt ein Pferd. Es raucht. In meinem Bett. Ich hasse es, wenn jemand in meinem Bett raucht. Mir ist schlecht.
„Was tust du hier?“
Ich sitze und rauche.
„Das sehe ich. Warum tust du das und warum hier, bei mir?“
Du hast mich gewonnen, weißt du das nicht mehr?
„Du bist ein Pferd!“
Und du bist ein Narr.
Mein Hirn ist leer. Mein Magen brennt. Meine Füße gehorchen nicht. Ich wische mir den Marmor von den Augen und starre es an. Seine Nüstern blähen sich dezent als es den Rauch ausstößt. Ich würde ihm später einen Kaugummi anbieten, nehme ich mir vor.
„Ich muss arbeiten. Du kannst nicht hier bleiben.“
Warum nicht? Ich wohne jetzt hier. Außerdem ist heute Sonntag. Niemand arbeitet am Sonntag.
„Du wohnst hier nicht. Du bist ein Pferd.“
Soweit waren wir schon. Und ich sagte, du bist ein Narr. Das langweilt. Lass uns frühstücken.
„Entschuldige, aber mein Hafervorrat für diese Woche ist bereits verbraucht. Ich hatte Schweinchen Babe gerade erst zu Besuch.“
Sarkasmus ist ein Hilfeschrei, wusstest du das?
„Jetzt weiß ich es. Was bist du, mein Therapeut, meine moralische Fliegenklatsche?“
Ich bin dein Pferd. Das muss reichen.
Ich bekomme Angst. Die Erinnerung an mein Gestern ist so rappig wie sein Fell. Schwarz und ohne jegliche Schattierung. Einfach nur schwarz.
„Hast du einen Namen oder soll ich dich einfach nur Pferd nennen?“
Nenn mich Areion.
Unter der Dusche gelingt es mir nicht, einen klaren Kopf zu bekommen. Bruchstücke vergangener Stunden schieben sich ins Schwarz meiner Gedanken. Ein Tunnel. Helles Klirren. Der Geruch von gebratenen Eiern…
„Was ist das?“
Wonach sieht es denn aus?
„Ich weiß genau, was das ist, nur begreife ich nicht, was das alles soll. Und zu deiner Information, ich esse keine Eier. Scheiße, Mann, du bist ein Pferd. Du stehst in meiner Küche und brätst mir Eier. Was soll ich davon halten?“
Wenn du keine Eier magst, dann nehme ich sie. Was willst du stattdessen, Haferbrei?
Ich lasse mich auf meinen Küchenstuhl fallen. Kraftlosigkeit besiegt meine Beine. Von meinen Haaren tropft Verzweiflung. Ein irres Kichern schiebt sich durch meine Brust.
„Kannst du auch Kaffee kochen?“
Ist das eine rhetorische Frage? Ich bin ein Pferd, das in deiner Küche steht und Eier brät, natürlich kann ich Kaffee kochen.
Das irre Kichern befreit sich aus meinen Rippen und erbrüllt sich in die Küchenzeile während sich das Pferd eine weitere Zigarette anzündet. Mit fünf Löffeln Zucker ersticke ich meinen Kaffee und nehme mir ebenfalls eine.
Du rauchst? Das ist ungesund, das weißt du.
„Wie gebratene Eier für Pferde.“
Punkt für dich.
„Und was hast du jetzt vor?“
Das Gleiche wie du. Ich bin dein Pferd. Was hast du vor?
Die tropfende Verzweiflung ist unter mir zu einer großen Pfütze geworden. Ich lasse mich vom Stuhl rutschen, tauche in die betrunkene Stille. Gleißend schließt sich der Himmel über mir. Schwimmen. Davonschwimmen. Dahinschwimmen. Entkommen. Benommen. Ich öffne die Augen…
Dein Kaffee ist tot. Zieh dir dein Mi-Parti an und lass uns grasen gehen, draußen scheint die Sonne.
Nostalgie
augenscheinlichGlänzende Aussichten
augenscheinlichEine Art Spiel
schreibchenweiseWas würdest du machen, wenn dies dein letzter Tag wäre?
Die Frage ist albern, dies ist nicht mein letzter Tag.
Und wenn doch?
Dann würde ich… ich weiß nicht, es gibt so Vieles, was ich dann gerne tun würde.
Was genau?
Du nervst, keine Ahnung. Vielleicht würde ich gerne all mein Geld abholen und auf einmal ausgeben. Einfach nur so, ohne an morgen zu denken. Ohne, dass die Bank anruft oder mein Konto sperrt. Shoppen bis zum Abwinken.
Dann hast du all den Kram gekauft, und dann? Dann ist dein letzter Tag vorbei und du kannst nichts damit anfangen.
Ich sagte doch, die Frage ist albern.
Denk nach. Die Frage ist nicht albern. Deine Antwort war es.
Na dann würde ich eben eine riesige Party feiern mit all meinen Freunden. Das wäre dann wie eine gigantische Abschiedsparty.
Aber die Organisation der Party würde doch schon deinen letzten Tag komplett vereinnahmen.
Herr Gott, dann eben keine Party. Ich denke, ich soll mir etwas wünschen?
Nicht wünschen, do sollst sagen, was du an deinem Letzten Tag im Leben machen würdest.
Das versuche ich ja, aber du lässt mich nicht.
Versuch’s noch mal, versuch’s besser.
Wenn dies mein letzter Tag wäre… jetzt ist es aber schon halb drei. Das ist ja gar kein ganzer Tag mehr.
Ich weiß.
Du spinnst.
Konzentrier dich, was würdest du tun?
Also dann würde ich vielleicht alles essen, was ich mir sonst immer verbiete. Ich würde Fettes und Süßes wahllos in mich reinstopfen, bis ich kotzen muss. Und dann würde ich weiter essen.
Du würdest dich tatsächlich an deinem letzten Tag, von dem du genau weißt, dass er gleich zu Ende ist, und ich meine zu Ende, nicht vorbei und ein nächster kommt, an dem würdest du dich mit irgendeinem Essen vollstopfen?
Was willst du eigentlich von mir? Es ist doch mein letzter Tag!
Eben, dann vergeude ihn nicht.
Was sollte ich denn deiner Meinung nach an meinem letzten Tag tun? Was würdest du denn machen?
Das erfährst du noch. Erst bist du dran.
Ist das eine Art Spiel?
Wenn du so willst. Ja, es ist eine Art Spiel. Also, mach weiter, denk nach. Was würdest du tun, wenn du genau wüsstest, ohne wenn und aber, dass dies dein absolut letzter Tag wäre?
Vielleicht würde ich einfach nur so da liegen, wie jetzt, in den Himmel schauen und nichts tun. Ich würde vielleicht darüber nachdenken, was ich bisher so gemacht habe und was nicht. Dann würde ich mich vielleicht an Dinge erinnern, die ich vergessen hatte, Dinge, wie einen flüchtigen Kuss oder eine zufällige Berührung. Ich würde mich an Kleinigkeiten erinnern wie den ersten Kratzer in meinem neuen Fahrrad. Ich würde vielleicht darüber nachdenken, dass ich dir einmal wehgetan habe. Ich würde daran denken, wie wir uns wieder vertragen haben. Ich würde mich vielleicht daran erinnern, wie es war, als mein Vater gegangen ist und meine Mutter tagelang weinte. Ich würde versuchen mir vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn meine beste Freundin nicht in eine andere Stadt gezogen wäre. Ich würde mich daran erinnern, wie es war, als ich Schwimmen lernte und fast ertrunken wäre. Dann würde ich vielleicht darüber nachdenken, wie es wäre, wenn ich reich wäre oder unsterblich, oder reich und unsterblich.
Und dann wäre dein letzter Tag vorbei und du hättest nur nachgedacht. Findest du das sinnvoll?
Ach jetzt muss es auch noch sinnvoll sein? Ich soll nicht blödsinnig konsumieren, ich soll mich nicht wahllos vollstopfen, ich soll nicht meine Zukunft bunt ausmalen, wie es mir gefällt – was willst du eigentlich, das ich tue?
Es geht doch nicht darum, was ich will, das du tust, sondern darum, was du wirklich tun solltest, wenn das dein letzter Tag wäre.
Dann lass ihn mich doch so gestalten, wie ich möchte.
Lass ich. Ich will dich nur sensibilisieren. Ich will dir noch eine Chance geben.
Was soll das denn jetzt. Das ist ein echt blödes Spiel.
Denk nach, denk richtig nach. Es ist dein letzter Tag. Du liegst neben mir, genau wie jetzt. Alles ist genau wie jetzt. Alles ist jetzt, jetzt ist alles. Heute ist dein letzter Tag. Was würdest du jetzt tun?
Dich küssen?
Falsche Antwort. Die Zeit und der Tod lassen sich nicht küssen, sie ficken dich einfach. Du hättest vorher wegrennen sollen…
Die brave Inge
schreibchenweiseVäter lieben ihre Töchter immer auf ganz besondere Weise…
Die kleine Inge war ein braves Mädchen. Sie trug brave Zöpfe, hatte brave Füße in brav gebundenen Schnürschühchen und einen braven Rock, der ihre braven Knie brav bedeckte. In Inges bravem Gesichtchen lächelte ein braver Mund, der nur ganz selten die kecke Zahnlücke entblößte. Dann wirkte die kleine Inge nicht mehr ganz so brav. Darum wollte ihr Vater, dass die kleine Inge den Mund lieber nicht öffnete, jedenfalls nicht, um so keck zu lachen.
Jeden Mittwoch ging die kleine Inge zum Ballettunterricht. Körperhaltung ist schließlich wichtig für eine junge Dame. Das fand auch Inges Mutter, die sehr darauf achtet, dass Inge Haltung bewahrte, auch außerhalb des Ballettraumes. Und Inge gab ihr Bestes – auch außerhalb des Ballettraumes. Inge half ihrer Mutter, wo sie nur konnte: im Haushalt, bei der Wäsche, bei der Versorgung der Hunde und bei der besonderen Betreuung ihres Vaters.
Darin war Inge gut, genau wie in der Schule. Ihre Noten lagen immer im oberen Durchschnitt, ganz zur Freude von Inges Lehrerin, Inges Mutter und zur besonderen Freude des Vaters. Brachte die brave Inge eine gute Note heim, dann gab es eine Belohnung, manchmal von der Mutter, meistens vom Vater. Überhaupt belohnte der seine kleine Inge besonders gerne und besonders oft. Er liebte seine Tochter – besonders.
Die brave Inge liebt Heiner, auch heute noch. Heiner ist schon etwas struppig, hat ein abgerissenes Ohr und ihm fehlt die karierte Weste, die er einst über der braunen Fellbrust trug, als der Vater ihn der kleinen Inge in den Arm legte. Als Belohnung, weil Inge so tapfer war. Jetzt ist Heiner fast nackt, ohne Weste, kaum noch mit Fell bedeckt. Aber das macht Inge nichts aus, Nacktheit kennt sie. Nacktheit ist in Inges Welt kein Tabu, denn Nacktheit gehört zu Inges Alltag wie einst der tägliche Weg zur Schule, der wöchentliche Ballettunterricht oder die regelmäßigen Besuche beim Vater. Den sah Inge oft nackt. Auch heute noch.
Früher, im Sommer, da spielte die kleine Inge gern nackt im Planschbecken der Nachbarn, zusammen mit Björn. Björn ist genauso alt wie Inge, ging aber noch nie zum Ballett. Björn war auch nie so brav wie Inge. Björn war manchmal sogar ein ganz schöner Rüpel, der sich prügelte und darum oft Schrammen hatte. Einmal kam Björn mit einem blauen Auge und einer Platzwunde am Kopf nach hause. Und wenn Björn dann lachte, weil er fand, dass ihm das gut stehen würde und ihn irgendwie männlich machte, hatte er genau so eine Zahnlücke wie Inge. Das fand auch Inge schön, denn so hatten die beiden etwas gemeinsam. Wenn Inge ihm daraufhin ein Pflaster auf seine Platzwunde klebte und ihm einen zarten Kuss darüber hauchte, dann war Björn gar kein Rüpel mehr, sondern einfach nur Björn. Inge hätte gerne viel mehr Zeit mit Björn verbracht, aber das ging damals nicht, weil Inge sich um ihren Vater kümmern musste.
Das tut sie auch heute noch. Und auch heute wird er ihr wieder sagen, dass er sie liebt und dass sie etwas ganz Besonderes für ihn ist. Auch heute wird er dabei nur still liegen bleiben und sie beobachten. Und wenn Inge dann Tränen in den Augen hat, wird er sie anschauen und sagen: „Sei brav, du schaffst das schon.“ So wie immer.
Und dann wird Inge weinend das Zimmer verlassen, in dem ihr Vater regungslos liegt, seit er vor Jahren diesen Unfall hatte. Sie wird ihren weißen Kittel ausziehen, die bequemen Schuhe gegen ein paar elegantere tauschen und nach Hause gehen, zu Björn.
Alte Zeiten
augenscheinlichIrgendwo in Frankreich, kurz vor der spanischen Grenze auf dem Weg nach Cadaqués, da liegt ein Paradies der vergessenen Seelen. Körper aus Blech, Sitze aus Moos. Einst waren sie groß und mächtig, nun sind sie Brachland, Pflanztöpfe für wildwucherndes Grün, stehen im rostigen Altenheim unter freiem Himmel. Manch einer beißt ins Gras.
Andy war hohl
schreibchenweise… aber er liebte seine Tomatensuppe, die ihn besonders an Tagen der Einsamkeit und Stille an die einzige Frau in seinem Leben erinnerte, die ihn glücklich machen konnte.
Er konnte wirklich nichts dafür, seine Mutter war Schuld. Als Andy noch ganz klein war, da sagte sie immer zu ihm: „Schatz, das musst du nicht wissen. Es reicht, wenn ich das weiß. Wenn du groß bist, dann ergibt alles schon einen Sinn.“ Und irgendwann gab Andy das Fragen auf und wuchs mit dem sicheren Gefühl der Pubertät entgegen, dass Mutti ihm schon sagen würde, wenn irgendetwas nicht stimmte. Oder wenn irgendwann der Sinn fehlte. Oder wenn er irgendwas oder irgendwen besser nicht anfassen sollte. Oder wenn er irgendwo besser nicht hinschauen oder hinhorchen sollte. So verschwanden allmählich die Worte der Neugier, dieses ständige Wieso, Weshalb und Warum, aus Andys Sprachgebrauch und an ihrer Stelle nistete sich Stille in seinem Kopf ein. Diese geistig-blasse Unberührtheit führte dazu, dass Andy unbeholfen aber glücklich wirkend durch seine Kindheit und Jugend tappte. Mitmenschen, die Andy nicht kannten, sagten hinter vorgehaltenen Händen, hinter vergilbten Gardinen und hinter flüchtig gestrichenen Wänden: Andy war hohl.
Ein wenig hatten sie wohl recht damit. Er war kein Genie oder Hochleistungssportler, wie sie in China geboren gezüchtet wurden. Er war auch kein Künstler, er trug weder eine exzentrische Frisur noch hatte er ein Gespür für Ästhetik. Er konnte weder malen noch singen noch sonst irgendwie musizieren noch schöne Skulpturen basteln. Hätte er geahnt, dass man allein durch die Abbildung einer Dose Tomatensuppe die Menschen begeistern könnte und sie einem dadurch Achtung und Respekt entgegenbringen würden, weil man etwas ganz Besonderes geschaffen hatte – weil man jemand ganz Besonderes war – er hätte vielleicht doch die ein oder andere Frage gestellt, er hätte vielleicht doch versucht, den ein oder anderen Zusammenhang zu begreifen und Rückschlüsse daraus zu ziehen. Das tat er nicht. Er aß still und geduldig die Tomatensuppe seiner Mutter, stippte Brot hinein, wunderte sich nicht, dass dieses erst schwamm und dann vollgesogen unterging um – wartete er zu lange – zu undefinierbaren Klumpen zu zerfallen und sich vollends aufzulösen. Er fragte auch nicht, warum es brannte, wenn er die kochend heiß servierte Suppe schluckte oder warum seine Mutter manchmal weinte, wenn sie sich nach dem Abwasch der Tomatensuppenteller allein in ihr Zimmer zurückzog und sich selbst Ohrfeigen gab, die dumpf klatschend durch die halb geschlossene Tür in den Flur schlichen.
Andy war hohl, das stand für alle fest, nur für seine Mutter nicht. Für sie war er etwas ganz Besonderes. Denn eines konnte Andy besser als all die Kinder seiner Schule und das war etwas, was neben den Lehrern auch seine Mutter sehr an ihm schätzte. Andy konnte stillsein und stillsitzen wie niemand sonst. Während andere plapperten, zappelten oder unentwegt etwas kaputt machten, während sie rannten, tobten, sich rauften und sich in ihrem jugendlichen Kräftemessen gegenseitig die Fäuste, Bäuche, Muskeln und Intimbereiche zeigten, saß Andy einfach nur da und… wartete. Andy wartete darauf, dass er endlich groß wurde und alles einen Sinn ergab, genau so, wie seine Mutter es ihm immer zu prophezeien pflegte.
„Hey, Schwachkopf! Du Hohlbirne, was sitzt’n da so dämlich rum? Auf was wartest’n? Auf die Zahnfee, dass die dir endlich mal einen runterholt?“
Andy kümmerte sich nicht weiter um solche Zurufe. Er hatte sich daran gewöhnt und auch daran, dass sie ihn wieder in Ruhe ließen. Sein stoisches Nichtreagieren auf jegliche Umwelteinflüsse oder menschliche Aufmerksamkeiten ließen ihn unantastbar werden. Es schien fast so, als hätte sich mit der Zeit um Andy eine Art Glocke gebildet, durch die keinerlei schulkindliche Angriffe zu ihm durchdrangen und durch die auch keinerlei Emotionalität mitteilsam nach draußen gelangte. Und irgendwann machten alle einen Bogen um Andy und ließen ihn das sein, was er war: ein stiller, nichtssagender Junge mit leerem Blick, der auf etwas oder jemanden zu warten schien. Das war gut. Er mochte es zu warten. Er mochte es, dass sich in seinem Kopf Milchglasstimmung ausbreitete. Und er mochte seine heiße Tomatensuppe mit Brotstippe, die er jeden Abend von seiner Mutter serviert bekam, auch wenn sie danach weinte.
Eines Tages war Andy 17. Es ging so schnell, dass seine Mutter einen Schreck bekam, als es soweit war. An Andys Waden sprossen dunkle Haare, sein Gesichtsausdruck wurde markanter, genau wie sein Geruch. Andy war noch immer hohl im Kopf, doch in seinem Körper regte sich dafür umso mehr Leben – Empfindungen, die er nicht einzuordnen, geschweige denn zu unterdrücken wusste. Das Stillsitzen fiel ihm zusehends schwerer und das Milchglas im Kopf wich einem kehligen Brummen, dessen Vibrationen sich bis hinab in seine Lenden schlichen.
Andys Mutter missfiel diese Veränderung ihres einzigen Sprosses, die selbst sie nicht aufzuhalten vermochte. Und sie hatte sich solche Mühe gegeben. An einem Donnerstag setzte sie darum zum unvermeidbaren Gespräch an. Dieser ungewohnte Ausflug in die Welt der Kommunikation irritierte Andy so sehr, dass er sich an einem Tomatensuppenstippbrotstückchen verschluckte, stark zu husten begann und sowohl Tomatensuppe als auch Brotstücken aus dem Mund zurück auf den Tisch und dort quer über Tischlaken und Geschirr verteilte. Zugegeben, vorher sah das abendbrotliche Arrangement etwas schöner aus.
„Ich weiß, das kommt jetzt überraschend, aber ich muss dir etwas erklären.“
Andy starrte seine Mutter mit offenem Mund an. Aus seinem Mundwinkel troff rote Stippe. Seine Augen spiegelten Verstörung. Während sie nach den richtigen Worten suchte, wischte Andys Mutter das verhustete Übel ihres Sohnes so gut es eben ging von der blütenweißen Jungfräulichkeit des Tisches.
„Du bist jetzt kein Kind mehr. Du bist fast so etwas wie…“ Sie stockte. „… wie ein Mann. Und, nun ja, als solch ein Mann wirst du wohl oder übel solch männliche Gefühle entwickeln, die…“ Und wieder suchte sie nach dem richtigen Vokabular, das ihr nicht so recht über die Zunge kommen wollte. Sie holte tief Luft und stieß den Rest des Satzes so stark und schnell hervor, dass Andy ein weiteres Mal geräuschvoll husten musste. „… im Geschlechtsakt mit einer Frau enden könnten.“
Und dann geschah etwas sehr Ungewöhnliches, etwas, das Andys Mutter als ausgestorben wähnte. Ihr Sohn stellte eine Frage.
„Was ist Geschlechtsakt?“
Das Geräusch, das auf diese Frage folgte, verankerte sich als sehr unangenehm in Andys Kopfstille. Es klang wie ein erwürgtes Schreien gefolgt von einem dumpfen Aufprall, dem ein Scheppern nachsprang. Als wieder Stille herrschte hing Andys Mutter in einer grotesken Pose inmitten von zerbrochenem Geschirr auf einem nicht mehr weißen Tischlaken eine Suppenschüssel umklammernd und verdrehte die Augen.
Andy saß nur da. Und wartete. Er wartet noch immer. Nur seine Jacke ist heute etwas eng und die Schnallen am Rücken drücken. Aber die Wände sind so herrlich milchig und es ist still, wie in seinem Kopf. Andy war glücklich.
Ich trage einen Fisch in mir
schreibchenweiseBetta splendens tanzt im Formenkreis, ein Auf und Ab, das jeden Kompass Lügen straft.
Ich trage einen Fisch in mir. Che Rry schmeckt seine Farbe, ihn schmückt ein schöner Schwanz. Betta splendens. Tief in meinem Herzen steckt eine seiner Schuppen. Es schmerzt ein wenig. Ich schlucke ein Rezept dagegen, das lärmt mich wieder still. Love is the Devil und der Fisch schwimmt weiter im Feuermeer. Er taucht. Unter. Ein. Nicht wieder auf. Und wenn, dann ringt er nach Luft.
Ich ringe nach Boden, denn meine Füße sind zum Fliehen da. Zum Treten. Ihre Spuren brennen sich in Haut, die Narben schlägt. Meine zieh’ ich einfach aus, springe aus dem Ichgewand. Dann liegt es dort. Am Boden. Stirbt. Jeden dieser Tage ein bisschen mehr. Der Fisch trägt Tränen. Aus meinen Augen tropfen seine Schuppen auf die Straße. Schaumnestpfützen. Und mir ist kalt dabei.
Fische schwimmen nicht auf Straßen, sie vertrocknen dort. Love is the Devil und mein Fisch wird auf dem Teer ertrinken. Schwarzer Teer. Roter Che Rry. Ich bleibe farblos.
An meinem Fenster
schreibchenweiseDu sollst nicht über Gullies geh’n, du sollst nicht in den Abgrund seh’n. Und wenn, dann nimm den Falco mit.
Regen peitscht bösartig die Straße, drischt wie eine kätzische Domina auf den Asphalt. Die Tropfen am Ende jeder Nasspeitsche zerplatzen. Und sterben. Unter der Straße zerrt ein Rauschen am Gehör. Die Unterwelt ist schwarzer Fluss. Ratten suchen nach einer rettenden Arche, Plastik verwirbelt sich ziellos in gurgelnden Strudeln. Staub ertrinkt. Oben weint die Nacht. Himmel und Horizont kopulieren während in den Häusern das Schweigen brüllt. Kaum ein Licht, keinerlei Herzschlag, Lebendigkeit „träuft mit Mozambin“ dahin und beginnt zu stinken.
Nur bei ihm ist Licht. Er blickt aus hohlen Augen, die in einem schönen Kopf stecken. Noch. Makellose Körper verkaufen sich besser. Für Intelligenz bezahlt kaum einer, wenn der Schwanz zu klein ist. Und es plaudert sich so schwer mit vollem Mund. Dieser ist so schön, so voll, so zartlippig, mit einem Zungenspiel, das bekannt, begehrt, berüchtigt fast. Ungedruckte Flugblätter zitieren seinen Namen von Ohr zu Ohr. Männer und Frauen verlangen nach ihm, auch weil er – oben wie unten, von hinten wie von vorne – eine Zier ist. Eine Gier ist. Weil er willig ist. Weil er billig ist. Noch.
Ich beobachte ihn und ihn und sie und ihn, sie alle, wie sie sich reiben, lutschen und winden, wie Zähne sich in Fleisch bohren, wie Brüste an Schwänzen ziehen, Zungen sich in welke Blüten schieben, wie alte Lenden auf pralle Ärsche klatschen. Ein Geräusch, genau wie das der Regenpeitschen. Draußen. Auf der Straße. An meinem Fenster. Ich wünsche mir die Nacht endlos. Ich bin in Raum und Zeit gefangen.
Die Gosse schläft nicht. Sie hält nur manchmal still, einen Moment lang, einen Zeigerschlag vielleicht, mehr nicht. Keine Zeit für Zeugen. Im Boden klafft jetzt ein Loch, das den Urin der Regenstraße schluckt, sich ergießt wie „die Donau außer Rand und Band“. Auf ihr schwimmt ein Schuh, stürzt sich hinab, wird Ratte mit zwei Senkelschwänzen. Der Gullydeckel gilt als vermisst, der Jüngling nicht. „Der hat sich verpisst!“ – schreit’s durch die Nacht. Ich schweige.
Mein Fenster bleibt leer, starre nur auf Wachs. Himmel und Horizont verlieren sich aus den Augen. Müde. Unter der Stadt liegt der Tod. Sein Mund war so schön, so voll, so zartlippig. Jetzt fehlt ihm ein Schuh.




















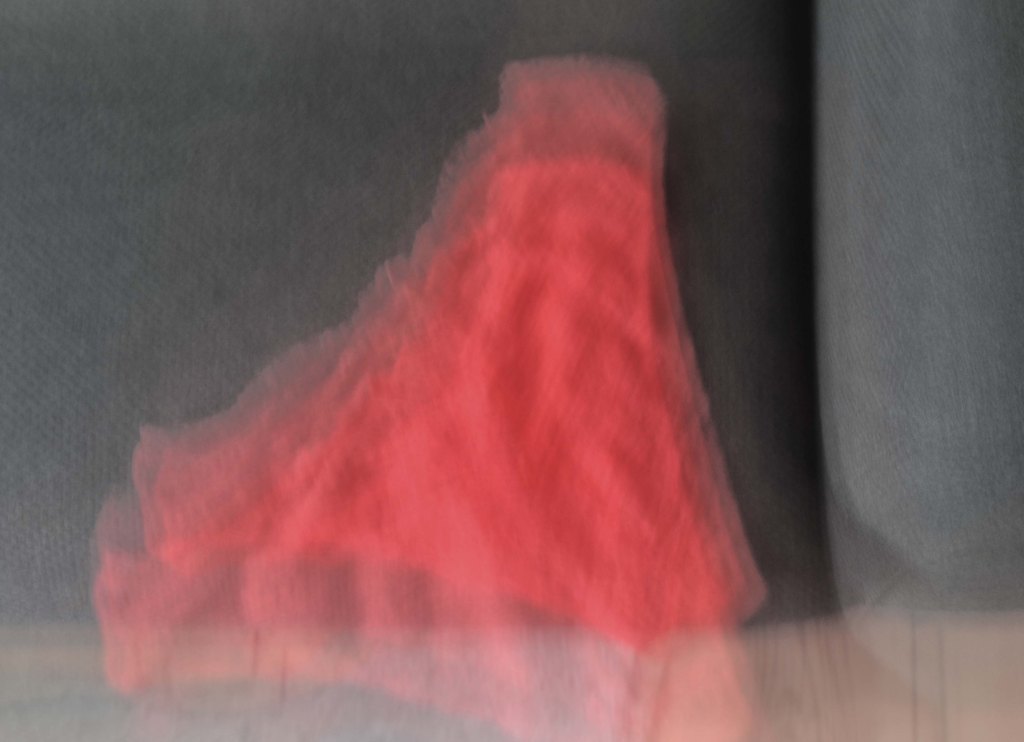


















Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.